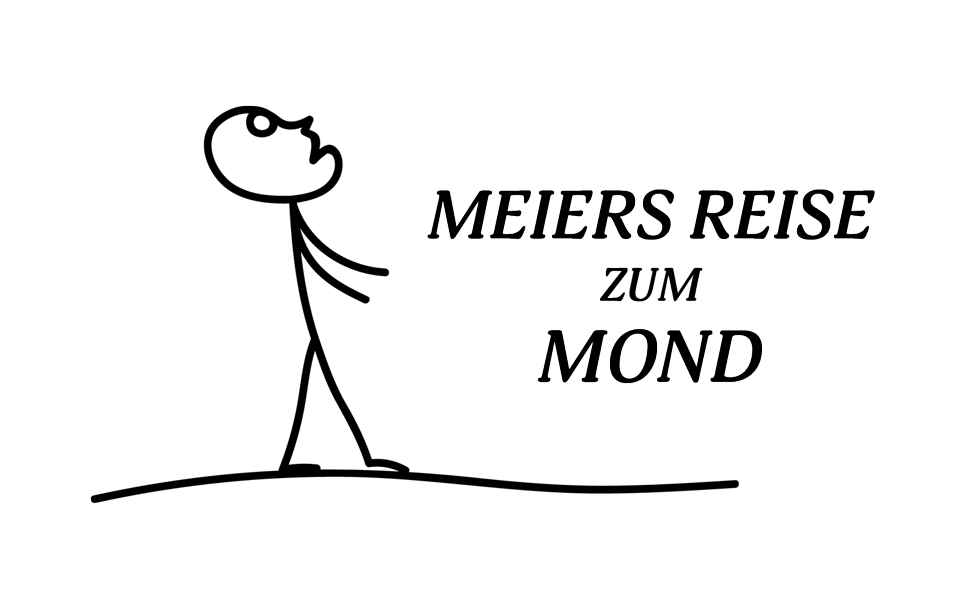Es ist alles sehr kompliziert.
Bio, Fairtrade, ökologischer Fußabdruck, Nachhaltigkeit. Endlich wird die Welt gerettet! Es tauchen dabei aber ein paar Fragen auf, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Über Verantwortung, Moral und Konsumtrottel.
„Moderner Ablasshandel“, so nennt Ralf Konersmann im aktuellen brand eins-Heft (auch online) die Kampagne von Krombacher, jener Biermarke, die versprach, mit jeder verkauften Kiste einen Quadratmeter Regenwald zu retten. Der Artikel beschreibt den schmalen Grat zwischen Moral und Moralisierung im ökonomischen Kontext.
Als Unternehmen moralisch zu handeln sei gut (Fair-Trade, Entwicklungshilfe, etc.), ändere aber am strukturellen Problem nichts und führe außerdem in den Industriestaaten zu einer Spaltung der Gesellschaft, zum „Konsumbürgertum“ also, das sich — analog zum Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert — über den unmoralischen, kurzsichtigen, ungebildeten, armen Pöbel erhebt. So die grobe Problematik spitz zusammengefasst.
Ich verstehe die Argumente. Und es ist klar, dass einzelne Unternehmen, wie LemonAid (die exemplarisch in dem Artikel zu Wort kommen und deren Engagement ehrlich wirkt) vermutlich nicht die Welt retten können. Und klar ist, dass es Unternehmen gibt, deren soziales und ökologisches Engagement nur soweit geht, wie es sich positiv in den Bilanzen niederschlägt und dort endet, wo es keine Beachtung mehr findet. Sex sells zwar immer noch, Nachhaltigkeit und gutes Gewissen aber eben auch. Da müssen wir uns nichts vormachen.

Welthandel – Lösung oder Ursprung vieler Probleme? Foto: meiersreisezummond.at
Bin ich also ein Konsumtrottel, der nun eben nicht mehr den röstfrischesten Kaffee, sondern einen fair gehandelten will? Bin ich als (im internationalen Vergleich) butterseitig auf die Welt Gefallener überhaupt in der Lage von „Moral“ zu reden, um im selben Moment Wirtschaftsgüter zu benutzen, von deren Entstehungsgeschichte ich nur erahnen kann, auf wessen Kosten sie entstanden sind?
Darf ich noch konsumieren, ohne mich schlecht zu fühlen? Und darf ich mich gut fühlen, wenn ich etwas konsumiere, dass angeblich fair gehandelt und produziert wurde, oder bin ich dann Teil des Konsumbürgertums, das die vorhandenen Handelsstrukturen festigt, Entwicklungsländer weiter abhängig macht und zur Spaltung der inner-industrialen Gesellschaft beiträgt?
Die Antwort auf all diese Fragen: Jein. Oder: Es ist alles sehr kompliziert.
Aber gehen wir die Probleme mal der Reihe nach durch:
Der Konsumtrottel. Der Konsumtrottel ist ja dann ein Trottel, wenn er kauft, ohne zu denken, bzw. alles glaubt, was ihm vom Marketing ins Hirn geblasen wird, ohne es zu hinterfragen. Dagegen kann man was tun. Recherchieren, nachdenken. Das ist anstrengend, das ist schwierig, in manchen Fällen vielleicht auch unmöglich. 100%ige Sicherheit, dass das, was draufsteht (oder recherchiert wurde) auch tatsächlich drin ist (sowohl Inhaltsstoffe als auch soziale und ökonomische Faktoren), wird man leider selten haben. Das Trotteltum wird aber durch Information immer kleiner. Das hoffe ich zumindest.
Die Moral-Berechtigung der Wohlstandsgesellschaft. Natürlich, es ist schon verlogen, nach ökologischen und sozialen Standards zu schreien, und dann die social response auf jenem Smartphone abzuchecken, das in China unter menschenunwürdigen Bedingungen zusammengeschraubt wurde. Oder mit dem Jutebeutel zum Biomarkt zu gehen, die Socken aber bei H&M zu holen.
Man muss da aber ein bisschen ausholen. Die Industrienationen haben eine technologische Entwicklung und einen Wohlstand ermöglicht, den wir eigentlich kaum noch wegdenken können. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Unterwerfung, der Mensch an sich ist — global betrachtet — eine soziale Katastrophe. Wir Westmenschen haben nun billige T-Shirts, tolle Smartphones, hippe Gadgets, Glutenunverträglichkeit — und: die Zeit, etwas über unser Handeln zu reflektieren.
Der Mensch an sich ist — individuell betrachtet — schon jemand, der zur Moral fähig ist. Darf er also den Wunsch haben, Moral auch im Supermarkt (oder Biomarkt) zu finden? Klar. Nur weil viel falsch läuft, muss es ja nicht so bleiben. Und wenn schon der Griff zu den „richtigen“ Produkten einen (vielleicht auch sehr kleinen) Teil dazu beitragen können, dass es zumindest nicht schlechter wird, na dann umso besser.
Das Sich-Schlecht-Fühlen beim Konsumieren. Ich kann nur von mir reden. Wenn’s der Geldbeutel zulässt, greif ich lieber zum fair gehandelten Produkt. Aber eigentlich nicht, weil ich mich schlecht fühlen würde, das normale Produkt zu nehmen, sondern weil ich in der Lage bin, das zu tun. Weil es ein kleiner Beitrag zu etwas sein kann, an das ich glaube: Dinge können besser werden. Es gibt Probleme, die ich nicht lösen kann, ich kann nicht in alle Kontinente reisen und allen Menschen zu Würde und Sicherheit verhelfen. Als Konsument kann ich aber jenen Unternehmen mein Vertrauen (=Geld?) geben, die versuchen, moralisch zu handeln. Auch hier: 100%ige Sicherheit wird es nicht geben. Und ja, klar könnte ich meine Sachen packen, meine Dinge verkaufen und ab in die Welt, leben von Luft, Liebe und Griesbrei in einer Welt, die weitab jeglichen Konsums existiert, vielleicht würde ich dort sogar glücklich. Aber ich will nicht. Ich bin sozialisiert in dieser Welt. Ich esse unglaublich gern Schokolade, trage T-Shirts, trinke Kaffee. Das ist meine Heimat. Die Industrie ist ein großes Feld, das von Angebot/Nachfrage, gesetzlichen Regelungen, Krisen, Konkurrenz und weiteren Faktoren bestimmt wird. Es ist nicht meine Schuld, dass es Dinge im Supermarkt zu kaufen gibt, die unmenschlich hergestellt wurden. Bzw. nicht meine alleinige. Das ist die Henne-Ei-Frage: Was war zuerst, der Konsument, der möglichst billig kaufen will, oder der Produzent, der möglichst billig herstellen will? Muss ich es gut finden, dass bei der Herstellung vieler Produkte die Menschenwürde mit Füßen getreten wird? Nein, natürlich nicht. Muss ich mich schlecht fühlen, wenn ich sie kaufe? Nein. Aber je mehr man darüber erfährt, wer aller darunter leidet, desto schwieriger wird es, das auszublenden und mit sich ins Reine zu bringen. Die Frage ist deshalb vielleicht nicht „Muss ich mich schlecht fühlen?“, sondern „Fühle ich mich manchmal schlecht?“ und da ist die Antwort oftmals dann doch: Ja.

Ich bin sozialisiert in dieser Welt. Ich trinke gern Kaffee. Foto: meiersreisezummond.at
Das Sich-Gut-Fühlen beim Konsumieren. Wir leben in diesem System, wir arbeiten, verdienen Geld, konsumieren Güter. Wenn es nicht zu einer Revolution kommt, die unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten umstürzt, wird das so bleiben. Derzeit ist die Macht der Revolutionäre überschaubar, auch die Macht der Bürger ist nicht so groß, wie man sich das in Demokratien eigentlich wünschen würde. Der Konsument jedoch hat noch Macht. Konsum ist in vielen Fällen nicht nur Güter-Beschaffung, sondern ein Zusammenspiel aus „was brauche ich“ und „wem gebe ich mein Geld“. Mit Ausnahme des Fairphones gibt es kaum elektronische Produkte, die moralisch hervorstechen, außerdem sind hier oft konkrete Erwartungen ans Produkt vorherrschend. Bei Produktgruppen wie Nahrungsmittel sieht die Sache anders aus, bzw. dreht sich auch die Erwartung ans Produkt hier zusehends: Tomaten müssen nicht billig und prall sein, sie müssen nach Tomaten schmecken. Die Zeit der roten Glashaus-Wasserkugeln ohne auch nur irgendeinen Geschmack ist hoffentlich bald überstanden. Bio-Tomaten, womöglich aus der Region, die womöglich echte Sonne gesehen haben, schmecken nämlich gut.
Darf ich mich also gut fühlen, wenn ich nachhaltige, faire, gute Produkte kaufe? Klar.
Wäre es wünschenswert, die unfairen Produkte nach und nach zurückzudrängen? Ja, definitiv.
Sind die anderen Konsumenten Schuld an den unfairen Bedingungen am Weltmarkt? Nein.
Hab ich eine Lösung für die sich festigenden Abhängigkeiten von armen Staaten? Nein. Sorry.